Aus aktuellem Anlass», heisst es gross auf der Titelseite des Buchs von Franziska Schutzbach, und die «Rhetorik der Rechten», die sie darin analysiert, ist ja wirklich aktuell, wenn auch bei den jüngsten Schweizer Abstimmungen und EU-Wahlen zumindest der ganz grosse Durchmarsch verhindert worden ist.
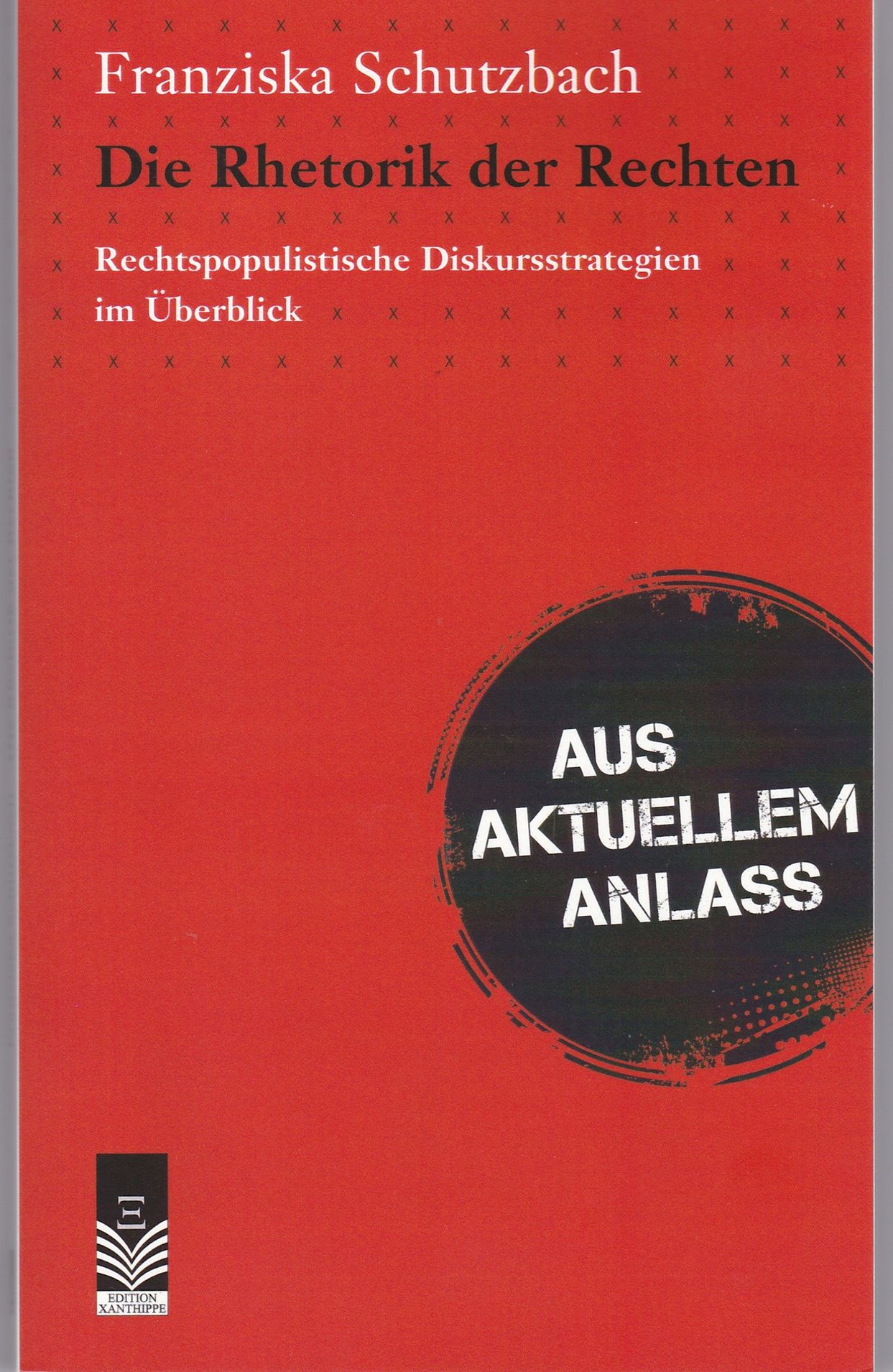 Aktuell, doch nicht neu. Man kann den Bogen zurückspannen. Etwa zu einem Sammelband über den «Rechten Populismus», wie er sic in Deutschland anlässlich der Kandidatur von Franz Josef Strauss als Bundeskanzler 1980 gezeigt hatte. Das Buch ist im bücherraumf vorhanden, so wie ein noch etwas älteres, nämlich «Zur Kritik der Weiblichkeit» der Wiener Frauenrechtlerin Rosa Mayreder, die sich darin schon 1905 mit allerlei reaktionären Sprachregelungen und Konzepten auseinandersetzte. Das Buch ist ein bemerkenswertes Dokument genauer Textlektüren und der Beschäftigung mit Alltagskultur anhand von so genannter Frauenliteratur oder Familienliteratur, was damals etwas anderes hiess als in unserem heutigen Verständnis.
Aktuell, doch nicht neu. Man kann den Bogen zurückspannen. Etwa zu einem Sammelband über den «Rechten Populismus», wie er sic in Deutschland anlässlich der Kandidatur von Franz Josef Strauss als Bundeskanzler 1980 gezeigt hatte. Das Buch ist im bücherraumf vorhanden, so wie ein noch etwas älteres, nämlich «Zur Kritik der Weiblichkeit» der Wiener Frauenrechtlerin Rosa Mayreder, die sich darin schon 1905 mit allerlei reaktionären Sprachregelungen und Konzepten auseinandersetzte. Das Buch ist ein bemerkenswertes Dokument genauer Textlektüren und der Beschäftigung mit Alltagskultur anhand von so genannter Frauenliteratur oder Familienliteratur, was damals etwas anderes hiess als in unserem heutigen Verständnis.
An den einleitenden Hinweis auf diese beiden älteren Werke durch Stefan Howald knüpfte Franziska Schutzbach in ihrem Referat im bücherraum f zu Beginn spontan an, indem sie die von Mayreder scharf analysierte Frauenfeindlichkeit als untergründigen, doch immer wieder heftig an die Oberfläche tretenden, Zug rechter, völkischer Bewegungen benannte. Nationalismus werde immer an militaristische Männlichkeit gekoppelt. Beim mörderischen Andres Breivik bestand die Hälfte von dessen Manifest aus einem gewalttätigen Antifeminismus, was in der Aufarbeitung eher unzulänglich reflektiert worden sei. Ja, der Antifeminismus diene mancher rechter Ideologie als «scheinbar unverdächtige Einstiegsdroge».
 Schutzbach ist Soziologin, Genderforscherin, Aktivistin und Publizistin, die sich immer wieder in aktuellen Debatten zu Wort meldet. Ihr Buch versteht sie als einen zusammenfassenden, didaktisch verfassten Beitrag mit eingreifender Absicht. Neben dem Antifeminismus charakterisierte sie verschiedene andere rechte Diskursstrategien. Dabei geht es ihr nicht um die extremsten Ausprägungen, sondern darum, wie rechtspopulistisches Gedankengut in den Mainstream eingedrungen ist, wie die Grenzen verwischt werden und es zu Normalisierungen kommt, durch gezielte Tabubrüche und Opferstilisierungen. Ein Motiv ist die Rede von den Ängsten der Abgehängten, Bedrohten, GlobalisierungsverliererInnen usw., die man ernst nehmen müsse. Aber dabei gilt es nach Schutzbach, projektive Ängste, die Missstände anderen – den Fremden, den Randständigen – zuschieben, von sozial bedingten Ängsten zu unterscheiden, die auch mit sozialen Massnahmen bekämpft werden können.
Schutzbach ist Soziologin, Genderforscherin, Aktivistin und Publizistin, die sich immer wieder in aktuellen Debatten zu Wort meldet. Ihr Buch versteht sie als einen zusammenfassenden, didaktisch verfassten Beitrag mit eingreifender Absicht. Neben dem Antifeminismus charakterisierte sie verschiedene andere rechte Diskursstrategien. Dabei geht es ihr nicht um die extremsten Ausprägungen, sondern darum, wie rechtspopulistisches Gedankengut in den Mainstream eingedrungen ist, wie die Grenzen verwischt werden und es zu Normalisierungen kommt, durch gezielte Tabubrüche und Opferstilisierungen. Ein Motiv ist die Rede von den Ängsten der Abgehängten, Bedrohten, GlobalisierungsverliererInnen usw., die man ernst nehmen müsse. Aber dabei gilt es nach Schutzbach, projektive Ängste, die Missstände anderen – den Fremden, den Randständigen – zuschieben, von sozial bedingten Ängsten zu unterscheiden, die auch mit sozialen Massnahmen bekämpft werden können.
Dominiert wird die gegenwärtige Diskussionskultur vom Topos der Ausgewogenheit. Jede kritische, linke Position muss angeblich mit einer rechten ausgeglichen werden; das klassische Beispiel sind die Diskussionssendungen im Fernsehen, schweizerisch oder deutsch. Doch diese Äquidistanz verbiete sich jegliche Frage nach der unterschiedlichen Qualität der Argumente. Lebhaft und anschaulich, immer wieder auf eigene Erfahrungen zurückgreifend, schilderte Schutzbach, wie sachliche Expertise durch politische Meinungen ersetzt werde. In Diskussionrunden über Rassismus oder Sexismus würden von jeglicher Sachkenntnis unbeleckte MeinungsmacherInnen eingeladen; dagegen müsse man ein Mindestmass an Expertise auch auf der rechten Seite anmahnen und gegebenenfalls die Teilnahme an einer Diskussion überdenken.
Die Schweiz ist, wie verschiedene Studien mittlerweile belegt haben, geradezu ein Versuchslabor für rechtspopulistische Strategien. Dabei zeigt sich eine Ambivalenz der direkten Demokratie. Diese gibt rechten Bewegungen Ausdrucksmöglichkeiten, etwa mit der Volksinitiative, bindet sie im konsensualen Regierungsstil aber immer wieder ein – wobei man das nicht als fixe Garantie verstehen darf.
Was tun? Gegen etwaigen Pessimismus bringt Franziska Schutzbach den verstorbenen deutschen Publizisten Sebastian Haffner in Anschlag, der vor der Gefahr einer «melancholischen Behaglichkeit» warnte. Wiewohl die Formulierung vom «Aufgeben als Kollaboration» ein bisschen stark wirkt, stiess die Kritik des Pessimismus auf weitgehende Zustimmung im Publikum, wobei man dazu vielleicht doch als Ergänzung das Gramsci-Motto gesellen könnte: Pessimismus des Verstands und Optimismus des Willens.
Tatsächlich wies Schutzbach auf die Dialektik politischer Bewegungen: Der neue Antifeminismus sei zweifellos auch eine Reaktion auf die erstärkte feministische Bewegung. «MeToo»: Das sei jüngst so allgegenwärtig gewesen, dass selbst sie sich manchmal schon beinahe genervt habe. So lasse sich das Patriarchat gegenwärtig vielleicht als angeschossenes Tier verstehen, das jetzt gefährlicher als je um sich schlage – offen musste bleiben, ob die Wunden schon tödlich sind.
Aber vielleicht müssen wir auch die Blickrichtung ändern, so sollte etwa in der Bildung neben der Kritik an den TäterInnen eher auf die Ermächtigung der Opfer gesetzt werden. Zugleich braucht es den Kampf um die Mitte. Von der muss eine, womöglich konservative, aber entschieden liberaldemokratische Haltung gefordert werden. Dies würde, von links her, bedeuten, Druck auf die Mitteparteien auszuüben und diese in eine Bündnispolitik einzubinden. Was den vehementen Hinweis hervorrief, der Ort der Kämpfe könne nicht nur die ideologische Auseinandersetzung sein, sondern Demokratiefeinde müsse man auch auf der Strasse konfrontieren.
Im lebhaften Austausch wollte man von Franziska Schutzbach wiederholt handfeste Tipps für den Alltag wissen; und einer stellte sich im Gespräch zweifellos heraus: Bei rassistischen, sexistischen Sprüchen zurückfragen. Argumente, Belege für Meinungen verlangen. Das bedeutet noch nicht, dass sich die Gegenüber überzeugen liessen, aber zumindest lassen sie sich ein wenig zum Nachdenken bringen, und ihre Meinungen lassen sich aufweichen. Allerdings müsse man realistisch bleiben und sich nicht in fruchtlosen Debatten aufreiben. Dabei betonte Schutzbach, dass auf verschiedenen Ebenen unterschiedliche Mittel angebracht und nötig seien. Im Alltag würde sie wohl so etwas wie «Sozialarbeit» versuchen; in der Öffentlichkeit dagegen müsse man klar fordern, antidemokratischen Kräften keine Plattform zu bieten. Wobei es nicht nur um die etwaige Zusammensetzung von Diskussionsrunden gehe, sondern auch um das framing, die Themensetzung und die Anlage von Debatten.
sh

