bücherräumereien (XVII)
Über den Rhein und zurück mit einigen Büchern.
Wann kommt denn endlich diese sagenhafte Rheinstrecke?, fragten wir uns, als wir kurz nach Weihnachten im Panoramawagen der Deutschen Bahn von Basel nach Köln reisten. Angesichts der eher langweiligen baden-württembergischen Tiefebene stimmte ich mich vorbeugend mit der Lektüre von Heines „Deutschland. Ein Wintermärchen“ ein, diesem „humoristischen Reiseepos“, wie Heine es selbst gegenüber seinem treuen Verleger Julius Campe angekündigt hatte. Die 1844 im Pariser Exil geschriebenen zahlreichen Vierzeiler in 27 Caput seien „ein ganz neues Genre, versifizierte Reisebilder und werden eine höhere Politik atmen als die bekannten politischen Stänkerreime“.
Gegen deren plakative Diktion war es Heines Versuch, den politischen Anspruch nicht preiszugeben, doch ihn mit Poesie und Romantik zu verbinden und deren mögliche Sentimentalität ihrerseits durch Ironie und Frivolität zu unterlaufen. 1843 war er nach 12 Jahren im Pariser Exil erstmals wieder nach Deutschland gereist. Diese temporäre Rückreise bildete der Text ab. Er beginnt mit einem glühenden Bekenntnis zur Freiheit und zu einer Diesseitigkeitsreligion:
Wir wollen auf Erden glücklich sein, Und wollen nicht mehr darben; Verschlemmen soll nicht der faule Bauch, Was fleissige Hände erwarben. Es wächst hienieden Brot genug Für alle Menschenkinder, Auch Rosen und Myrten, Schönheit und Lust, Und Zuckererbsen nicht minder. Ja, Zuckererbsen für jedermann, Sobald die Schoten platzen! Den Himmel überlassen wir Den Engeln und den Spatzen.
Danach steigt er zuweilen in die Niederungen des kulturellen Handgemenges, schreckt auch vor Kalauer und Witzchen nicht zurück. Die Weiterarbeit am Kölner Dom wird als Symbol der zu befürchtenden Vorherrschaft Preussens verdammt, und Heine wünscht sich, dass er nie vollendet werde, was von heute aus gesehen doch ein wenig denkmalstürmerisch erscheint. Da ich von der Lektüre aufblickte, kam, nach Mannheim, die sagenhafte Rheinstrecke doch noch in den Blick, das linksrheinische Ufer des Flusses, der mir kein „Vater Rhein“ sein konnte, gelegentlich verbaut, gelegentlich frei sichtbar, an und ab ein träges Schiff darauf, ein mächtiger Strom, eingezwängt zwischen zwei Hügelzügen, erstaunlich hoch und eng, beinahe klaustrophobisch, das trübe Wetter half nicht; immerhin war der Service der Deutschen Bahn besser als ihr ramponierter Ruf.
In der Bilkerstrasse
Von Köln später mit dem Vorortszug nach Düsseldorf, wo das Heinrich-Heine-Institut zeigt, was alles in Heine drinsteckt. Das Institut, zugleich Forschungsstätte und Museum sitzt in einem hübschen klassizistischen Haus, das Museum nimmt zwei Stockwerke ein. Die Darbietung zu Leben und Werk ist eher traditionell, in Schaukästen, mit etlichem Text, moderne Medien werden nur für ein wenig Nachleben in Videos verwendet. Eingangs will Heines Haarlocke von Authentizität zeugen und zehren, dabei waren solche Haarlocken schon zu Zeiten Heines Tod beinahe eine industrialisierte Reliquie – von welchem Dichterjüngling gäbe es keine? Aber die Auswahl der Themen ist plausibel und konzentriert, die Texte sind knapp und kenntnisreich. Heines Herkunft aus einer jüdischen Familie, zwischen Erfolg und antisemitischer Ausgrenzung. Erste Erfolge, erstes Engagement. Danach die Flucht aus dem dumpfen Deutschland nach Paris. Die Präsenz in verschiedenen Szenen, im direkten Kontakt mit der ganzen französischen Kulturwelt und im indirekten mit der deutschen; von den Franzosen geschätzt, von Deutschen aufgesucht, mit vieler Erwartung im Heimatland – ein wahrer übernationaler Geist, und gerade das „Wintermärchen“ bezeichnet exakt die Ambivalenz des Exilierten.
Hierauf die gescheiterten Hoffnungen von 1848, in beiden Ländern, und schliesslich die Matratzengruft in Paris. Dazu passend die Frauen, die er doch ziemlich – ziemlich – gleichberechtigt behandelte, und der irdische Sensualismus – die Zuckererbsen –, den auch der Linksbüchnerianismus schon in „Dantons Tod“ als Erbschaft Heines für Büchner reklamiert hat. In einigen Videoaufnahmen dann Vertonungen und Verfilmungen von Heine-Texten, zwischen bittersüss und bitterbös.
Schon im Vorfeld der Reise gab es eine überraschende aktuelle Anknüpfung. Der chinesische Künstler und Dissident Ai Weiwei erklärte in einem Interview im Mai 2019, Heines „Wintermärchen“ schon mit zehn Jahren gelesen zu haben. Darin habe er so viel Schönes, Wertvolles und Humorvolles gefunden. „Der Typ ist verrückt. Ich liebe ihn.“ Und in einem im Tages-Anzeiger gedruckten Interview doppelte er kurz vor Weihnachten nach und zitierte Heines Satz, wonach die Liebe zum Vaterland ins Exil zwinge.
Im Eingang des Museums steht eine alte Truhe, mit ausgemusterten Büchern. Nicht gerade aus dem Institut, weil da doch einige Schätze zu erwarten wären, sondern von Angestellten und dem Publikum gespiesen, breit gestreut, vom Reiseführer über den Durchschnittskrimi bis zu wissenschaftlichen Werken, darunter eine Studie zu Peter Weiss, die doch tatsächlich in meiner Sammlung fehlt, weshalb ich sie, in Ermangelung einer Gegengabe in Form eines Buchs im Austausch für einen freiwilligen Obolus, mitnahm.
Den Hinweis auf den winzigen Fehler in der Ausstellung, den ich mit einem entschuldigenden Witzchen monierte – nichts Gewichtiges, eine einfache Verwechslung einer Bildlegende zu einer Abbildung, die Clara Schumann als Karl Gutzkow missinterpretiert –, stiess beim Aufsichtspersonal nur auf mässiges Interesse – solche Besserwisser sind wohl nicht gar so selten.
Abschweifung mit Jonas Fränkel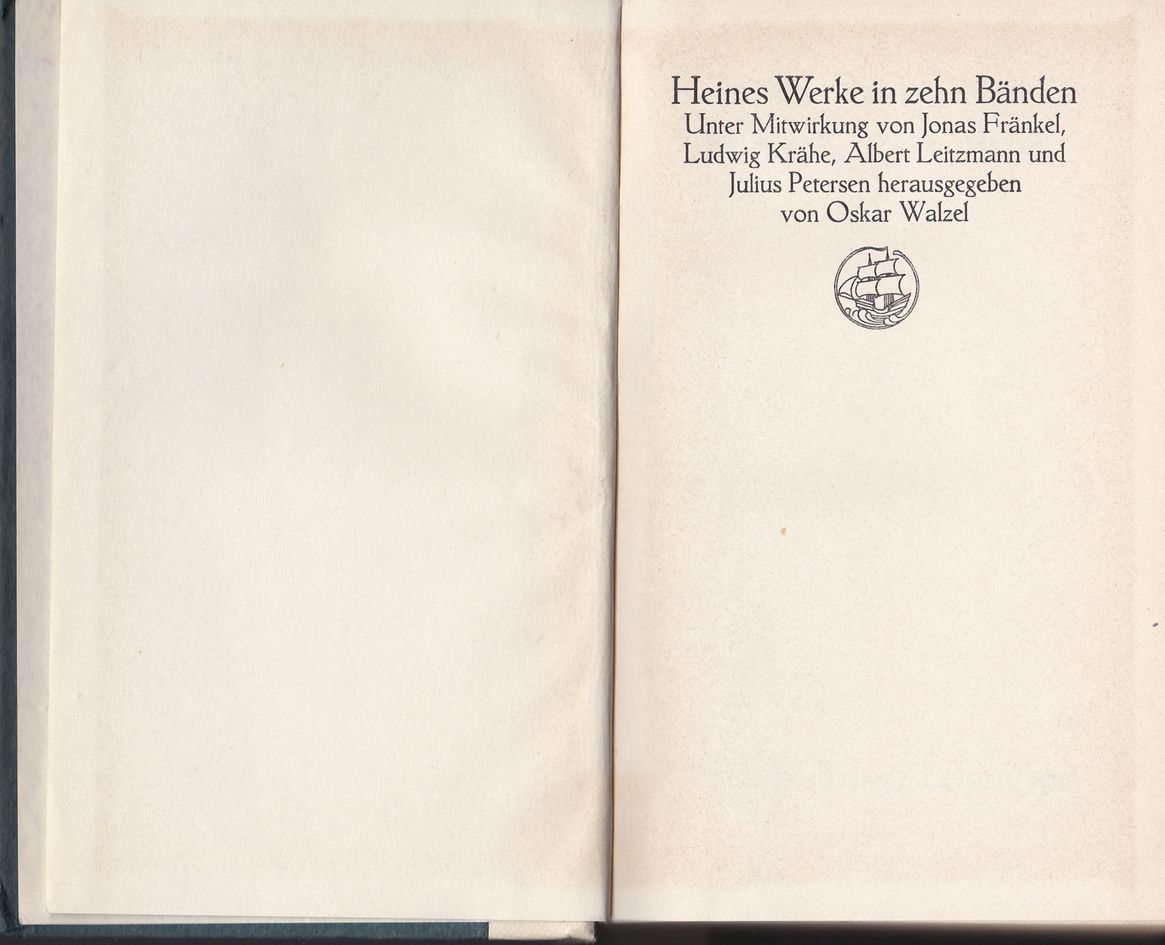
Im bücherraum f findet sich eine Leipziger Heine-Ausgabe aus den 1910er-Jahren, nicht ganz alle zehn Bände, aber doch die wichtigeren Texte, so in Band 2 auch das „Wintermärchen“. Hergerichtet ist dieser Band wesentlich von Jonas Fränkel. Dieser jüdisch-österreichisch-schweizerische Philologe (1879 – 1965), der sich zuerst als Privatgelehrter, dann als zumindest ausserordentlicher Professor an der Uni Bern mehr schlecht denn recht durchschlug, legte sich in der Zwischenkriegszeit mit seinen textkritischen Gottfried-Keller- und Carl-Spitteler-Ausgaben mit dem schweizerischen Kulturestablishment an, oder besser: dieses legte sich mit ihm an, indem ihm nicht nur Steine in den wissenschaftlichen Weg gelegt wurden, sondern man ihn faktisch auf übelste Weise ausbootete, wobei der gutbürgerliche nationalkonservative Antisemitismus nicht fehlen durfte. Die Person und die Causa Fränkel würden eine grössere Studie verdienen. Der Publizist Fredi Lerch hat sich einmal um eine solche bemüht, länger daran gearbeitet, sich dann aber offenbar mit dem Sohn Fränkel nicht über die Benutzung des Nachlasses einigen können und deshalb das „Projekt Fränkel“ schliesslich abgebrochen, wie er auf seiner Website dokumentiert hat (www.fredilerch.ch). Auch Charles Linsmayer hat zur skandalösen Ausgrenzung Fränkels ein paar deutliche Worte gesagt (www.linsmayer.ch).
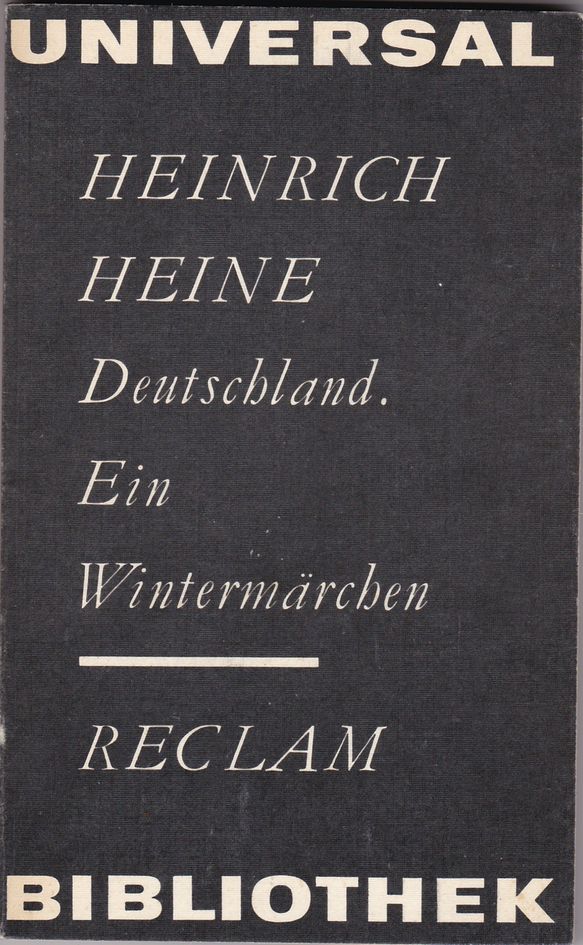 Meine Heine-Ausgabe, die ich im Zug las, war ein Reclam-Bändchen, nicht aus Stuttgart freilich, sondern aus Leipzig, also aus den Beständen der längst untergegangenen DDR. Die Edition stützt sich auf die Ausgabe von Fränkel, dessen Verdienste anerkannt werden; das Nachwort häuft dann die damals üblichen Sprechblasen an. Man musste Heine ja lobpreisen, ohne die von ihm so geschmähte Politliteratur vollkommen abzuwerten und aufzugeben. Also hebt man Heine in die grösseren, schon beinahe überzeitlichen Werte hinauf, die er den Politliteraten voraus gehabt habe, bescheinigt ihm eine „überlegene geschichtliche Einsicht“, und natürlich darf auch der Bezug darauf nicht fehlen, dass er damit das deutsche „Volksschicksal als Ganzes“ in dessen historischer, menschheitsgeschichtlicher Mission im Auge gehabt habe – solchen Sätzen haben wir einst, peinlich berührt sei es gesagt, einen kritischen Kern und eine historische Berechtigung abzugewinnen versucht.
Meine Heine-Ausgabe, die ich im Zug las, war ein Reclam-Bändchen, nicht aus Stuttgart freilich, sondern aus Leipzig, also aus den Beständen der längst untergegangenen DDR. Die Edition stützt sich auf die Ausgabe von Fränkel, dessen Verdienste anerkannt werden; das Nachwort häuft dann die damals üblichen Sprechblasen an. Man musste Heine ja lobpreisen, ohne die von ihm so geschmähte Politliteratur vollkommen abzuwerten und aufzugeben. Also hebt man Heine in die grösseren, schon beinahe überzeitlichen Werte hinauf, die er den Politliteraten voraus gehabt habe, bescheinigt ihm eine „überlegene geschichtliche Einsicht“, und natürlich darf auch der Bezug darauf nicht fehlen, dass er damit das deutsche „Volksschicksal als Ganzes“ in dessen historischer, menschheitsgeschichtlicher Mission im Auge gehabt habe – solchen Sätzen haben wir einst, peinlich berührt sei es gesagt, einen kritischen Kern und eine historische Berechtigung abzugewinnen versucht.
Item, im bücherraum f sind einige Bände der Leipziger Ausgabe einzusehen und Heines Vielfalt zu erlesen: Politik und Romantik und Ironie
sh

