Bücherräumereien (XVIII)
Streiflichter auf die «Neue Schweizer Rundschau», Wahnsinn, Idealismus und ein Seehundsgebiss.
Friedrich Hölderlin und Walter Benjamin: Das sind nur zwei der Namen, die in der «Neuen Schweizer Rundschau» um 1930 auftauchten. Die NSR war eine Monatszeitschrift mit bemerkenswert breitem Horizont, die 1907 als «Wissen und Leben» begonnen hatte und 1926 zur «Neuen Schweizer Rundschau» mutierte.
Die Nummer vom Juli 1931 beginnt kulturbeflissen genug, mit einem Beitrag über «chinesische Heiterkeit» und einem Auszug aus André Gides Drama «Oedipus». Dann folgt der Beitrag «Ein deutsches Gespräch» von Franz Blei, das zwischen einem mittelalterlichen Rheinländer, einem älteren Österreicher und einem jungen Bayern geführt wird. «Irgendein Anlass» lässt die drei das Gespräch mit Hölderlin beginnen, den der Bayer bewundert. Nicht so sehr als Dichter, wie der erzählende Österreicher vermutet: «Ich bin geneigt anzunehmen, dass er sich mehr mit Hölderlin dem deutschen Patrioten beschäftigt, auf der Suche nach dem geistigen Rüstzeug für seine politische Gesinnung. Er ist nämlich Nationalsozialist mit grossen Zweifeln an dem Hitler, geringeren an dem Goebbels und gar keinen an Ernst Jünger, Frontsoldat gleich ihm».
mittelalterlichen Rheinländer, einem älteren Österreicher und einem jungen Bayern geführt wird. «Irgendein Anlass» lässt die drei das Gespräch mit Hölderlin beginnen, den der Bayer bewundert. Nicht so sehr als Dichter, wie der erzählende Österreicher vermutet: «Ich bin geneigt anzunehmen, dass er sich mehr mit Hölderlin dem deutschen Patrioten beschäftigt, auf der Suche nach dem geistigen Rüstzeug für seine politische Gesinnung. Er ist nämlich Nationalsozialist mit grossen Zweifeln an dem Hitler, geringeren an dem Goebbels und gar keinen an Ernst Jünger, Frontsoldat gleich ihm».
Nun feiern wir eben gerade Hölderlin zum 250. Geburtstag, siehe die kommende Ausgabe der WOZ vom 19. März, und da bleibt die konservative, ja faschistische Indienstnahme Hölderlins ein Thema. Im Aufsatz von Blei wird sie sozusagen im Gedankenlabor untersucht. Ausgangspunkt sind nicht iegendwelche Inhalte, sondern die Form der späten Gedichte, die der Bayer als «Hymnen in freien Rhythmen» bezeichnet, was der Österreicher als Widerspruch in sich abtut. Mehr noch, er findet bei Hölderlin immer wieder Lücken, die dieser «im fortreissenden Duktus» offen gelassen habe, um sie später womöglich auszufüllen, oder auch nicht. Für den Bayer hingegen «fehlt da nichts». Dahinter steckt dann doch eine inhaltliche Differenz, weil, wie der Österreicher meint, der Bayer «an dem Geschlossenen und Vollendeten dieser letzten Kompositionen des Dichters eben wegen deren Dunkelheit im Ganzen deshalb so interessiert [ist], weil sich daraus am besten das erlesen lasse, was ihm zu finden im Sinn liege: den prophetischen Seher, der den Nationalsozialismus voraussage». Der Österreicher hält den National-Sozialismus für einen Widerspruch in sich, zwischen dem Nationalen und Sozialen, was unweigerlich zur Sprengung führen müsse. Das ist historisch insofern berechtigt, als wenige Jahre später der «soziale» Flügel um Otto Strasser liquidiert wurde, unterschätzt aber doch den Nationalsozialismus und dessen Fähigkeit, Widersprüche für seine Anhänger lebbar zu machen.
Nicht vorhandener Wahnsinn
Von Hölderlin geht das Gespräch über den Nationalismus und das vermeintliche Deutschtum zu Ernst Jünger und der Kriegsverherrlichung, bis zum Schluss Hölderlin nochmals gestreift wird: «Dem Österreicher gefiel es, die Frage zuzuspitzen. […] Er griff auf Hölderlins nicht vorhandenen Wahnsinn zurück und auf das Erleiden einer ihm mässig feindlich gesinnten Umgebung, die ihn isolierte.» Diese recht abgewogene Darstellung wird nun tatsächlich weiter zugespitzt anhand des Serienmörders Peter Kürten, der damals eine Zelebrität war, und der «wie Hölderlin» sein Leben unbedingt leben wollte – was nun nicht nur beim Bayer, sondern auch beim Leser, ja beim Österreicher selbst eine Irritation auslöst, so dass er sich, nachdem er sich von seinen Gesprächspartnern verabschiedet hat, in einer Coda zu erklären versucht. Am Extremfall von Kürten könne der Ort des Mörderischen in unserer Gesellschaft bestimmt und zugleich die falsche Ansicht bekämpft werden, erfülltes Leben bestehe im Ausleben höchster Spannung, was etwa die Kriegsverherrlichung von Jünger und das Raubtierverhalten des Nationalsozialismus zumindest ideologisch abzuwehren vermöchte – wobei die Beziehung zu Hölderlin denn doch als eine fragwürdige Zuspitzung, womöglich Verirrung erscheint.
Hölderlin war übrigens schon früher in der NSR aufgetaucht: Franz Zinkernagel hatte 1926 in Heft 4 «Neue Hölderlin-Funde» vorgestellt, im Vorfeld der von ihm verantworteten Hölderlin-Gesamtausgabe. Es handelte sich dabei um zwei Jugendgedichte und einige Jugendbriefe, ferner um drei Fragmente, die schon in den 1840er Jahren von Christoph Schwab gesammelt worden waren. Darunter der Ansatz zu einem «novellenartigen Dialog», mit dem schönen Titel «Communismus der Geister», der durchaus communistisch das Gemeinschaftliche meint, aber doch vor allem im Bereich des Geistes als Bildung einer deutschen Akademie.
Idealismus des guten Willens
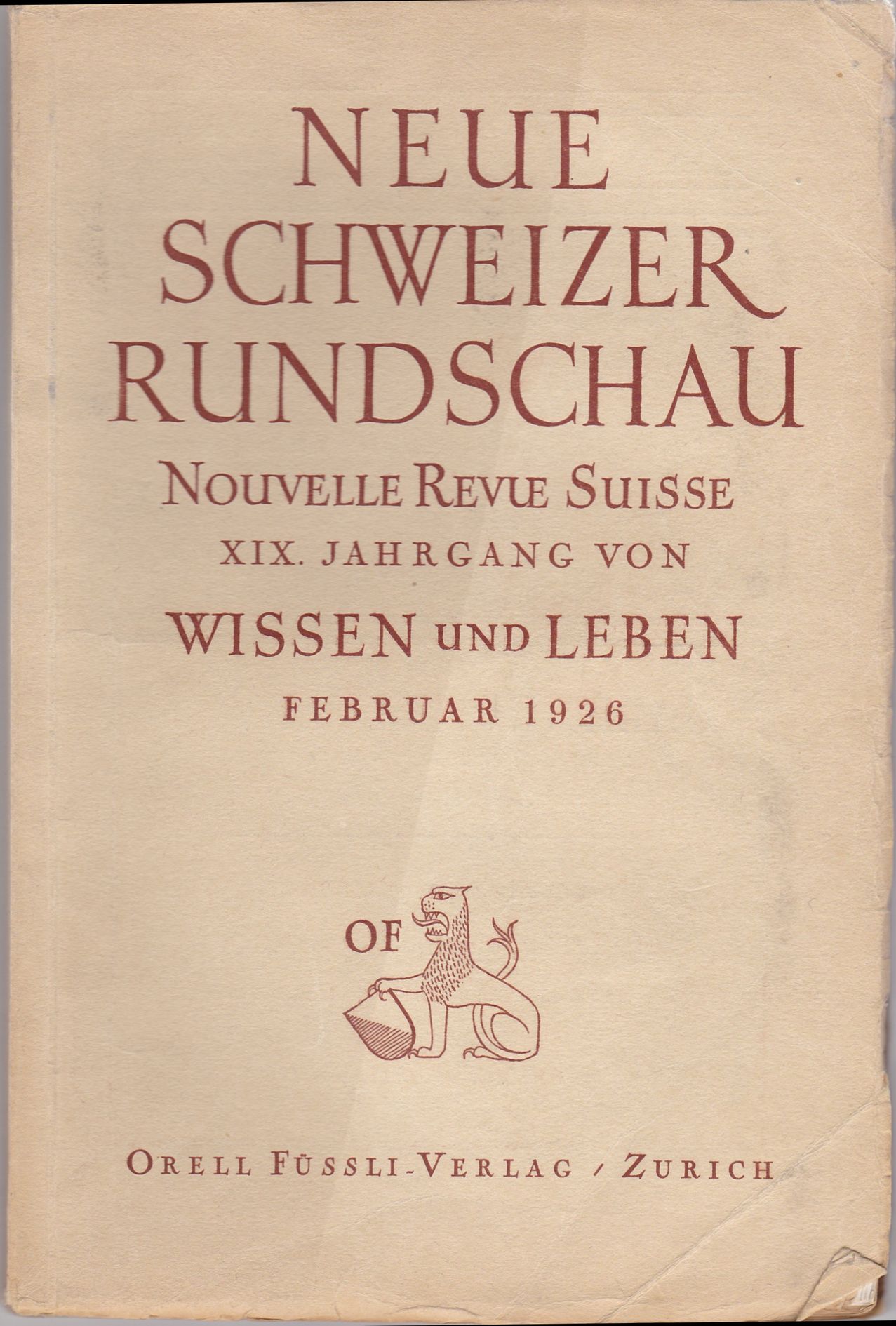 «Wissen und Leben» wurde 1907 massgeblich von Ernest Bovet (1870–1941) begründet, mit einem weit zielenden, selbstbewussten Namen, und formulierte im Editorial der ersten Nummer als Absicht die «Schaffung engerer Beziehungen zwischen Wissenschaft und Praxis, nicht nur um einer guten Popularisierung und vielseitigen Kultur zu dienen, sondern und hauptsächlich um die Entwicklung kräftiger, zielbewusster Individualitäten in idealistischer Richtung zu fördern». Bovet, Romanistikprofessor an der Uni Zürich, war ein umtriebiger Intellektueller, der nacheinander als Präsident des Schweizer Heimatschutzes und als Generalsekretär der Schweizerischen Vereinigung für den Völkerbund amten konnte. «Wissen und Leben» wollte gegen den schnöden Materialismus einen Idealismus des guten Willens fördern, distanzierte sich von jeder politischen Parteirichtung, vertrat aber durchaus fortschrittliche Postulate in der Sozialpolitik und setzte sich auch etwa für «volle Frauenrechte» ein.
«Wissen und Leben» wurde 1907 massgeblich von Ernest Bovet (1870–1941) begründet, mit einem weit zielenden, selbstbewussten Namen, und formulierte im Editorial der ersten Nummer als Absicht die «Schaffung engerer Beziehungen zwischen Wissenschaft und Praxis, nicht nur um einer guten Popularisierung und vielseitigen Kultur zu dienen, sondern und hauptsächlich um die Entwicklung kräftiger, zielbewusster Individualitäten in idealistischer Richtung zu fördern». Bovet, Romanistikprofessor an der Uni Zürich, war ein umtriebiger Intellektueller, der nacheinander als Präsident des Schweizer Heimatschutzes und als Generalsekretär der Schweizerischen Vereinigung für den Völkerbund amten konnte. «Wissen und Leben» wollte gegen den schnöden Materialismus einen Idealismus des guten Willens fördern, distanzierte sich von jeder politischen Parteirichtung, vertrat aber durchaus fortschrittliche Postulate in der Sozialpolitik und setzte sich auch etwa für «volle Frauenrechte» ein.
1926 dann erschien sie mit neuem Namen und in neuem Gewand, weiterhin unter der redaktionellen Leitung von Max Rychner (1897–1965), der die Leitung 1922 übernommen hatte. Während die beiden ersten Jahrgänge noch bei Orell Füssli erschienen, wurde sie ab 1928 im Eigenverlag der Neuen Schweizer Rundschau mit Sitz bei Girsberger & Cie in Zürich herausgegeben.
Fünf Ausgaben liegen im bücherraum f vor, eine kleine Auswahl, doch zeigt sie die weit gespannten Themenbereiche, die frei schwebenden, zuweilen auch widersprüchlichen Ansätze und Positionen, wobei die Lektüre manche historischen Beziehungen aufspannt.
So enthält die Nummer vom Februar 1926 zuerst einen Schwerpunkt zur Religion, mit Beiträgen zum protestantischen Kirchenproblem und zum katholischen Kardinal J. H. Newman. Gleich anschliessend folgt ein Beitrag zur Psychoanalyse als Weltanschauung, der bemerkenswert positiv daherkommt. Er wiederum wird gefolgt von einem Beitrag über die «Amerikanerinnen», in einem Stil verfasst, der sich feuilletonistisch munter gibt, aber schon damals kaum fürs minderste Feuilleton taugte. Verfasser ist ein Reinhard Weer, wie es heisst «Schriftsteller in Zürich», und wenn man den einzigen weiteren Beitrag von ihm, der sich im Internet aufspüren lässt, als Massstab nimmt, dann ist es kein grosser Verlust, dass er seither als Autor vergessen gegangen ist. Gleich anschliessend berichtet ein Dr. jur. Ernst Honegger über die Säkularisierung in der Türkei; auch ihm haben es die Frauen angetan, so dass er tief in die Vergleichskiste der Zoologie greift: «die Haartracht zwar noch wohl bedeckt, doch ohne Schleier, so dass ihre ewig gleichen, scheuen Antilopen-Gesichtchen sich offen geben, knuspern auf den grossen Sandhaufen mit kleinen Bissen an ihren Maiskolben, so wie Eichhörnchen knuspern». Kulturgeschichtlich bemerkenswert kommt auch er auf die «Psychanalyse» zu sprechen und mutmasst, warum diese weder in der Türkei noch in Rumänien bisher habe Fuss fassen können. In ersterer sei man unhinterfragt in einem Kulturkreis eingeschlossen, in zweiterem würden die Triebe ausgelebt; in beiden Ländern seien entsprechend Mechanismen der Verdrängung nicht nötig – dieser angeblich wohlwollende Exotismus lässt dann allerdings auch durchblicken, dass auch die Sublimierung nicht vorhanden sei.
Ein angestocktes Seehundsgebiss
In der Nummer vom März 1927 steht ein Beitrag des deutschtümelnden Literaturprofessors Josef Nadler neben einer scharfen Abrechnung mit dem französischen nationalistischen Antidemokraten Charles Maurras. Bemerkens- und lobenswert ist die internationale Perspektive, in Politik wie Kultur. Anfang 1929 finden sich zum Beispiel ein Beitrag von Ernst Robert Curtius zu James Joyce, Texte von und zu Lytton Strachey, dazu Analysen jüngerer französischer Literatur. Wenig später, in der Nummer vom April, gibt es einen Schwerpunkt zu Bertrand Russell, und dann stösst man auf einen Beitrag von: Walter Benjamin. «Marseille» gehört zu einer Reihe von Städtebildern, die Benjamin, nachdem ihm eine akademische Karriere verwehrt worden war, zum Geldverdienen schrieb. Aus der selben Reihe hatte die NSR schon einmal, im Oktober 1928, einen Beitrag über «Weimar» abgedruckt. Marseille erscheint Benjamin als «gelbes, angestocktes Seehundsgebiss», das nach «schwarzen und braunen Proletenleibern» schnappt. Tatsächlich spürt er, wie Peter Szondi in einem Nachwort zu einem 1992 veröffentlichten Band solcher Städtebilder meint, dem Sozialen, Gemeinschaftlichen als Gegenstück zu der schmerzhaft erlebten Vereinzelung nach; das Metaphorische, das Szondi bei Benjamin feiert, kann ich am Beispiel von Marseille freilich nicht in allem als gelungen nachvollziehen.
Der Verlag der Neuen Schweizer Rundschau gab auch eigene Bücher heraus, etwa von Max Scheler und C. G. Jung. Die Zeitschrift wurde dann im April 1955 eingestellt, womöglich, weil ihre internationalistische Ausrichtung im beginnenden Kalten Krieg nicht mehr auf Interesse stiess. Rychner seinerseits hatte schon 1931 nach Köln gewechselt und war bis 1937 als Redaktor der «Kölnischen Zeitung» und Korrespondent der «Neuen Zürcher Zeitung» tätig. Nach zweijähriger Tätigkeit als Feuilletonchef beim Berner «Bund» leitete er von 1939 bis 1962 die Kulturredaktion der «Tat» in Zürich – das ist eine andere Geschichte.
Im bücherraum f sind folgende Nummern der «Neuen Schweizer Rundschau» vorhanden: 2/1926, 3/1927, 1/1929, 4/1929, 7/1931.
